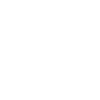Mitte April hat der Europäische Rat die kontinentale Urheberrechtsreform verabschiedet. Artikel 11 ist einer der umstrittensten: Hier ist der Grund
Am 27. März 2019 hat das Europäische Parlament mit großer Mehrheit die kontinentale Urheberrechtsreform (im Parlamentsjargon: Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt) verabschiedet, die wesentliche Änderungen bei der Verwaltung und Verteidigung des Urheberrechts vorsieht. Derselbe Text wurde am 15. April 2019 vom Europäischen Rat ratifiziert (gegen die Stimmen Italiens und anderer Staaten) und wurde damit praktisch zu einem Gesetz der Europäischen Union.
Der Genehmigungsprozess der EU-Urheberrechtsreform war alles andere als einfach. Das erste "Ja" des Straßburger Parlaments sollte eigentlich im Sommer 2018 kommen, aber die verschiedenen Proteste, die erhoben wurden, haben die Genehmigung um mehrere Monate verzögert. Insbesondere die Artikel 11 und 13 (die in der endgültigen Fassung des EU-Urheberrechtsgesetzes zu Artikel 15 bzw. Artikel 17 wurden) zogen die Aufmerksamkeit der Kritiker auf sich. Ersteres verändert die Beziehung zwischen Verlegern, Journalisten und Nachrichtenaggregatoren (wie z. B. Google News); letzteres erlegt den Betreibern von Portalen, die auf nutzergenerierten Inhalten basieren (wie z. B. YouTube), strengere Kontrollen auf, um die Veröffentlichung von urheberrechtlich geschützten Inhalten zu verhindern.
Wikipedia hat seine Website wiederholt geschwärzt (oder die Bilder der Stichwörter schwarz abgedeckt); YouTube hat mehrere Tage lang eine Warnung auf seiner Startseite angezeigt; Google hat die Anzeige seiner Suchergebnisse geändert, um zu zeigen, wie sich die Suchergebnisseiten aufgrund der neuen Urheberrechtsvorschriften ändern könnten. Neben den Internetgiganten haben auch Verbände zur Verteidigung der Meinungsfreiheit, Digitalaktivisten und Experten für IT-Recht und geistiges Eigentum einen Appell verfasst und unterzeichnet, um die Annahme des Textes zu verhindern.
Urheberrechtsreform: Was ändert sich für Nutzer und Websites
Die Auswirkungen des neuen EU-Urheberrechts werden nicht sofort spürbar sein. Gemäß dem EU-Gesetzgebungsverfahren haben die einzelnen Mitgliedstaaten nun zwei Jahre Zeit, das Gesetz zu ratifizieren und in nationales Recht umzusetzen. Während dieser Zeit können die nationalen Parlamente eingreifen und bestimmte Details des Textes korrigieren (aber nicht den Sinn ändern). Ganz zu schweigen davon, dass die Wahlen zur Neubesetzung des Europäischen Parlaments am 26. Mai das derzeitige Gleichgewicht im Straßburger Plenarsaal stören könnten, was sich auch auf die Reform des Urheberrechts auswirken könnte.
Artikel 11 der Urheberrechtsreform: Was er besagt und wie er das Internet verändern soll
Artikel 15 des neuen europäischen Urheberrechtsgesetzes mit dem Titel "Schutz journalistischer Veröffentlichungen bei digitaler Nutzung" wurde geschaffen, um die Beziehungen zwischen Verlegern und Autoren von Inhalten sowie Portalen zu regeln, die Nachrichten sammeln und zusammenfassen (Aggregatoren). Bislang kann jeder einen Aggregator einrichten und den Nutzern ermöglichen, sich durch das Lesen von Schlagzeilen und kurzen Auszügen auf dem Laufenden zu halten, ohne dafür zu bezahlen. Es handelt sich um eine Art Suchmaschine, die eine Tageszeitung "zusammenstellt", die immer mit den aktuellen Nachrichten aktualisiert wird. Einige Beispiele? Das bereits erwähnte Google News, aber auch Flipboard, Feedly, Diggita und viele andere.
Nach Artikel 15 der Urheberrechtsrichtlinie (also dem ehemaligen Artikel 11) sind Plattformen, die Auszüge aus journalistischen Inhalten veröffentlichen, verpflichtet, vorab eine Lizenz vom Rechteinhaber einzuholen. Natürlich kann der Verleger oder Journalist von dem Unternehmen, das die Aggregatoren oder Plattformen verwaltet, die Snippets (d. h. kurze Auszüge, die in der Regel aus einem Titel und einer kurzen Beschreibung des Inhalts bestehen) veröffentlichen, eine angemessene Vergütung verlangen. Derselbe Artikel sieht jedoch auch Ausnahmen vor: Wenn nur der Link oder "einzelne Wörter oder kurze Auszüge" veröffentlicht werden, ist keine Zahlung erforderlich. In der europäischen Gesetzgebung wird jedoch nicht präzisiert, was unter dem Begriff "kurze Auszüge" zu verstehen ist (wie viele Wörter macht ein kurzer Auszug aus? 5, 10, 15?), und es ist leicht vorstellbar, dass die Verhandlungen zwischen Verlegern, Journalisten und Internetunternehmen genau diese Definition betreffen werden.
Die Auswirkungen, die die Regelung haben könnte, betreffen jedoch nicht nur Portale, die Nachrichten aus verschiedenen Quellen zusammenfassen. Selbst wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, führt eine einfache Suche in einer Suchmaschine wie Google, Bing, Yahoo! oder Ariadne unweigerlich zu mindestens einem journalistischen Ergebnis. Wenn Sie beispielsweise nach einem Leitfaden für die Aktualisierung von WhatsApp suchen (ein Thema, das offensichtlich nichts mit journalistischen Fragen zu tun hat), werden Sie feststellen, dass die meisten Ergebnisse von Zeitungen oder "ähnlichen" Plattformen stammen. Kurz gesagt, wenn die Urheberrechtsrichtlinie im digitalen Binnenmarkt in Kraft tritt, werden sich nicht nur die Aggregatoren verändern, sondern auch die Suchmaschinen.
Einen Vorgeschmack darauf, wie das Web in einigen Jahren aussehen könnte, hat Google bereits gegeben. In den Tagen der Debatte im Straßburger Plenarsaal hat die Suchmaschine schlechthin ein Experiment gestartet, indem sie die Anzeige der Ergebnisse im Zusammenhang mit der neuen europäischen Norm geändert hat. Die Snippets von Zeitungen und Informationsportalen sind durch Links zum Inhalt oder höchstens zum Titel ersetzt worden. Nach Angaben des Unternehmens aus Mountain View sank der organische Verkehr der Portale, die an dem Experiment teilnahmen, um etwa 30 %.